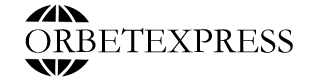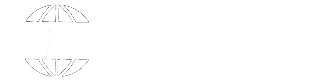Album der Woche:
»Pimmel weg, Pimmel weg, jetzt ist Schicht im Schacht«, lautet das einführende Mantra im griffigen und auf 140 bpm recht sanft gleitenden Titeltrack »Fotzen an die Macht«. Ja, das reimt sich; in der nächsten Zeile sogar noch einmal mehr, wenn Katharina »Kat« Hoffmeister und Nina Geßler postulieren: »Ich will, dass alles hier zusammenkracht«. Gndz-gndz-gndz hämmert die Computerbassdrum, Presslufthammer-Beats gegen das Patriarchat.
Fotzenrap nennt sich das Genre, in dem 6euroneunzig sich seit einem guten Jahr einen immer klangvolleren Namen neben Kolleginnen wie Ikkimel, Zsá Zsá, Mariybu oder Vicky erspielt haben. Dabei ist ihre Musik eigentlich eher Kirmes-Techno und ihr »Rap« weniger Flow als ein mokantes Deklamieren mit Endreim-Finish.
Mit den ersten großen Hits des Duos, darunter »Tittentraining« und »Slutalarm« (»Baby, heut nehm ich dich hart ran/ Und danach noch deinen Nachbarn«), hätte man jede FLINTA*-Party am Ballermann zum Kochen gebracht, mal angenommen, so etwas gäbe es auf Mallorcas Amüsiermeile.
Mehr zu Ikkimel und Fotzenrap lesen Sie hier .
So etwas gibt es definitiv in Berlin, der Heimatstadt von Kat und Nina, die sich ihr Frauenrap-Projekt am Küchentisch ihrer WG ausgedacht haben, nachdem sie sich bei einem Schauspielcasting in Potsdam kennengelernt hatten und kurzerhand zusammengezogen waren. »Da haben wir so gemeinschaftlich in der Küche gesessen und gesagt, hey, lass mal irgendwie was schreiben«, sagte Kat dem Berliner »Tages«.
Auf 6euroneunzig als Bandnamen kamen sie in einer Bar, bei der es Drinks zur Happy Hour zu diesem Preis gab. Das Ganze sei »eher so aus einem gemeinschaftlichen Spaß-Ding entstanden«. »Pussypop«, ihre bisher beste Pop-Hymne, bringt diesen Anarcho-Charakter wirkungsvoll auf den Punkt: »OMG, wir gehen heut bekloppt/ Titten zeigen, Arsch wackeln/ Wir nehmen Männer hops«.
Wie bei Ikkimel und Co. dominiert auch in ihren Reimen die krasse Provokation mit schamlos betitelten weiblichen Intimkörperteilen und Ermächtigungsposen. Sie selbst sind dabei die Bitches, Huren und Bad Girls, die den Jungs ihr Mackergehabe ins Feminine n und es dann in die empört aufgerissenen Hälse hinunter stopfen. Ein großer, gemeiner Spaß. Erste Videos von 6euroneunzig wurden auf TikTok und anderen Plattformen auch deshalb so populär, weil sie so viel Aufrufe und Hasskommentare durch wütende Kerle generierten.
Auf ihrer zweiten EP mit zehn kurzen, prägnanten Stücken geht es manchmal etwas bemüht lustig gegen alte Männer wie den Weihnachtsmann (»Hoe, Hoe, Hoe«), dumpfe Kneipen-Anbaggerer (»Stalker Alert«), Cis-Hetero-Mansplainer, die sich für Feministen halten, aber nix kapiert haben (»BWL Justus«) oder, in »Scheiße am Schuh«, schlicht den Ex, der sich schlecht benommen hat (»Wünsch dir ’ne Schlafparalyse, ’ne Analpolype«). Autsch.
Damit ließen sich noch viele Partys und Festivals bespielen. Im »Tages«-Interview hatten die beiden 26-Jährigen jedoch bereits im vergangenen Juni angekündigt, dass sich das Sex- und Sexismus-Thema womöglich bald erschöpfen könnte. Aber was dann?
»Alles brennt« enthält erste Hinweise auf neue Themen wie Klimakrise und soziale Klüfte (»Eat the rich«). Angst vor Endbossen und -gegnern haben 6euroneunzig jedenfalls nicht, wenn sie im Titeltrack die beiden übelsten Machos des Globus auftreten lassen – und mokant unterwerfen: »Trump und Putin werden zu meinen Knechten/ Erst mal Liebesschule und dann haben sie wieder Rechte«. Wenn jetzt noch die Musik dazu etwas weniger eindimensional wird, kann’s losgehen mit der Machtübernahme. (7.5/10)
Kurz Abgehört:
Mandy, Indiana – »URGH«
»Urgh«, also etwa: »Igitt« in Großbuchstaben, so fasst die Band Mandy, Indiana den Weltekel zusammen, den sie auf ihrem zweiten Album verhandeln. Vor drei Jahren veröffentlichte die Band aus Manchester mit der Pariser Sängerin Valentine Caulfield ein beeindruckend abrasives Debüt, irgendwo zwischen DAF-Prototechno, Industrial Noise, MRT-Klopfgeräuschen und schleifenden Sequenzer-Loops.
So nervenzerrend geht es nun auch in »Sevastopol« weiter, das von dem russisch annektierten Hafen auf der Krim handelt und mit einem grellen Motorsägengeräusch beginnt: So kann man den tödlichen, seit vier Jahren quälenden Krieg in der Ukraine auch illustrieren, ohne dass man die auf Französisch geknurrten oder gestöhnten Texte versteht.
»Lasst alle Hoffnung fahren«, stößt Caulfield in »Magazine« hervor, einem fast beschwingt klöppelnden Techno-Track, der am Ende schrill in einem Soundschredder zerfetzt wird. »A Brighter Tomorrow« ist eine unheimliche Atempause in der Mitte des Albums, ein geisterhaftes Herumstolpern in einem akustischen Wasteland voller leer drehender Spulen und Getriebe.
Immer wieder bäumen sich die Tracks gegen den einmal eingeschlagenen, in »Sicko« oder »Cursive« durchaus poppigen Groove oder Rhythmus auf, explodieren in kathartischem Lärm gegen die Resignation, das Abfinden mit den Verhältnissen, dem Krieg, dem Leid und dem Schmerz, so wie in »Ist halt so«, einem besonders brutalen, offensichtlich von der Zeit im Berliner Aufnahmestudio beeinflussten Stück über Bomben, Hass und Gaza. Ein Album, so glühend kalt und beißend wie dieser Winter. (8.3/10)
Joji – »Piss In The Wind«
Laut Plattenfirma hatte das neue, vierte Album des japanisch-australisch-amerikanischen Popkünstlers Joji bereits mehr sogenannte Pre-Saves als Über-Popstar Charli xcx mit ihrem neugierig erwarteten Soundtrack-Album zum Film »Wuthering Heights«. Das heißt übersetzt, dass mehr Leute sich für Joji interessierten und deswegen seine Musik abspeicherten, bevor man sie überhaupt hören konnte.
So unauffällig wie sein Name – und auch seine supersofte, zeitgeistgerecht triefnasig dahinplätschernde Post-R&B/Trip-Hop-Musik – verlief dessen Karriere nicht immer, was diesen Erwartungsvorschub und die verblüffende Popularität erklären mag: Joji, der eigentlich George Miller heißt, begann vor etwa 15 Jahren als YouTuber mit lustigen, »Jackass«-artigen Comedyvideos, die er in seiner »Filthy Frank«-Show vorführte, später als »Pink Guy« in einem rosafarbenen Kondomanzug.
Er gilt als Erfinder des »Harlem Shake«, einem der ersten viralen Dance-Memes von 2013, als alle plötzlich zu dem gleichnamigen EDM-Track von Baauer wild herumzappelten. Erst seit 2017 veröffentlicht er introvertiertere Musik als Joji und war kurz darauf mit seinem Album »Ballads 1« der erste aus Asien stammende Künstler mit einer Nummer eins in den US-Billboard-Charts.
»Piss In The Wind« fügt diesem damals gefundenen, offenbar sehr erfolgreichen Soundkonzept wenig Originelles hinzu, mal klingt Joji wie Blood Orange (»Last of a Dying Breed«), mal wie James Blake (»Can’t See S*** in the Club«), oft nach Justin Bieber ohne dessen einprägsame Stimme – aber immer so knapp daneben, als hätte eine KI die Komposition übernommen. Mit 21 Tracks ist das viel pseudobesinnliche Klangtapete für die Spotify-Crowd. Vom Meme-Künstler zum musikalischen Mime-Artist. (3.5/10)
Rapperinnen 6euroneunzig: »OMG, wir gehen heut bekloppt«
Foto: Ben Otto Hoffmann