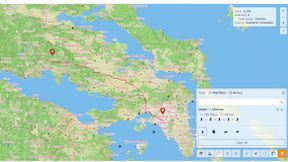Neun verschiedene Belastungsgrenzen hat das Erdsystem, und davon sind mittlerweile sieben überschritten – eine mehr als im Vorjahr. Zu diesem Ergebnis kommt der am Mittwoch veröffentlichte »Planetary Health Check 2025«-Bericht des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Neu im Gefahrenbereich: die Ozean-Versauerung. Hauptursache sei die Verbrennung fossiler Energieträger, verstärkt durch Abholzung und Landnutzungswandel.
Seit Beginn der Industrialisierung sei der pH-Wert der Ozeanoberfläche um rund 0,1 pH-Werteinheiten gesunken, heißt es in dem Bericht. Das bedeute eine Zunahme der Versauerung um 30 bis 40 Prozent. Die Meere verlieren dem PIK zufolge dadurch zunehmend ihre stabilisierende Rolle im Erdsystem. Die Folgen seien bereits spürbar: Kaltwasserkorallen, tropische Riffe und arktische Ökosysteme gerieten unter Druck.
Auch zeigen laut PIK winzige Meeresschnecken, sogenannte Flügelschnecken , bereits Schädigungen an ihren Schalen. Sie seien eine wichtige Nahrungsquelle für Fische und Wale.
Luftverschmutzung und Ozonschicht im sicheren Bereich
Die nun sieben überschrittenen planetaren Grenzen sind demnach:
Klimawandel,
Integrität der Biosphäre – die Autoren verstehen darunter, wie stabil und widerstandsfähig das »Netz des Lebens« auf der Erde ist, also ob genug Arten, Lebensräume und ökologische Funktionen erhalten bleiben, damit die Natur ihre Aufgaben erfüllen kann,
Veränderung der Landnutzung – also wie stark Menschen die Landschaften der Erde verändern, etwa indem sie Ackerflächen, Viehzucht und Siedlungen ausweiten oder Wälder abholzen,
Veränderung des Süßwasserkreislaufs,
Veränderung der biogeochemischen Kreisläufe, also der natürlichen »Recycling-Systeme« der Erde, in denen lebenswichtige Elemente wie Stickstoff und Phosphor zwischen Boden, Wasser, Luft und Lebewesen zirkulieren,
Eintrag menschengemachter Substanzen – gemeint sind Stoffe wie Plastik oder Schwermetalle, die der Mensch in die Natur »eingeschleppt« hat,
Ozeanversauerung.
Alle sieben zeigen den Forschenden zufolge in eine bedenkliche Richtung.
Zwei der ausgewiesenen Belastungsgrenzen liegen laut Forschern noch im sicheren Bereich: die Belastung durch Aerosole (Luftverschmutzung) und die Ozonschicht. Sobald eine Grenze überschritten wird, steigt laut Forschern das Risiko, die wichtigen Funktionen der Erde dauerhaft zu schädigen, sowie die Wahrscheinlichkeit, dass Kipppunkte überschritten werden, die Veränderungen unumkehrbar machen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beobachten diese Grenzen anhand zentraler Indikatoren.
Anhaltende Warnsignale
»Der Zustand unseres Planeten verschlechtert sich massiv«, betonte Johan Rockström , PIK-Direktor und Co-Autor des Berichts. »Die Menschheit verlässt ihren sicheren Handlungsraum und erhöht so das Risiko, den Planeten zu destabilisieren.« Bereits vor mehr als 15 Jahren erfand er das Modell der planetaren Grenzen. Damit wollte er messen, wie weit die Zerstörung der Lebensgrundlagen auf der Erde vorangeschritten ist und wo bereits rote Linien übertreten werden.
»Die Entwicklung geht eindeutig in die falsche Richtung. Die Ozeane versauern, Sauerstoffwerte sinken, und marine Hitzewellen nehmen zu. Damit wächst der Druck auf ein System, das für stabile Lebensbedingungen auf unserem Planeten unverzichtbar ist«, sagte Levke Caesar , Leitautorin des Berichts.
Die Versauerung sei ein unübersehbares Warnsignal, dass die Stabilität der Erde in Gefahr sei, sagte die US-amerikanische Ozeanografin und Mitglied der Initiative »Planetary Guardians« , Sylvia Earle.
Einheitliche Bewertungsmaßstäbe fehlen
Die Autorinnen und Autoren weisen selbst darauf hin, dass es für einige planetare Grenzen erhebliche Unsicherheiten gibt, weil Messdaten, weltweite Standards oder Bewertungsmaßstäbe fehlen. Wie bei allen globalen Umweltindikatoren gibt es zudem methodische Debatten: Welche Kontrollvariablen sind am besten geeignet? Wie werden Schwellenwerte festgelegt? Wie gut lassen sich globale Durchschnittswerte auf regionale Unterschiede abbilden? Einige Forschende fordern etwa, die Wechselwirkungen und Rückkopplungen zwischen den einzelnen Grenzen noch stärker zu berücksichtigen.
Manche Stimmen aus Politik und Wirtschaft hatten anlässlich des Reports von 2024 kritisiert, dass die Ergebnisse alarmistisch dargestellt seien. Das könnte Menschen überfordern oder resignieren lassen, so die Befürchtung.
Die Autorinnen und Autoren verstehen die Werte selbst als Schätzungen, die weiterentwickelt werden müssen. Am Ende ist es jedoch Interpretationssache, was politisch oder moralisch als »Risiko« und als »schlimm« verstanden wird.
Positivbeispiel Ozonschicht
Rockström betonte derweil einmal mehr, dass ein globales Umsteuern möglich sei. Die Erholung der Ozonschicht sei ein Beispiel dafür. In den Achtzigerjahren wurde weltweit erkannt, dass bestimmte Industriechemikalien – vor allem FCKW – die schützende Ozonschicht der Erde zerstören. Die internationale Gemeinschaft reagierte darauf mit dem Montreal-Protokoll, das 1987 beschlossen wurde und den Einsatz dieser Stoffe schrittweise verbot. Durch die konsequente Umsetzung dieser Vereinbarung konnte der Ausstoß der schädlichen Substanzen drastisch reduziert werden.
In den Folgejahren zeigte sich, dass sich die Ozonschicht langsam erholt – ein Beweis dafür, dass gemeinsame, entschlossene Maßnahmen auf globaler Ebene tatsächlich große Umweltprobleme lösen können. »Scheitern ist kein zwangsläufiger Ausgang, es liegt an uns, es zu verhindern«, sagte Rockström.
Fest steht aber auch: Die globale Temperatur und die Emissionen steigen weiter. Das Jahr 2024 markierte den historischen Sprung über die 1,5-Grad-Marke . Die1,5-Grad-Grenze, auf die sich die Weltgemeinschaft im Jahr 2015 verständigt hatte, gilt als gefährdet. 2025 bleibt das Temperaturniveau hoch, mit einzelnen Monaten knapp unter dem Wert.