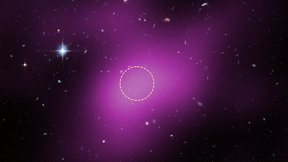Charles nennt sich selbst den König des Waldes. Sein Zuhause ist die kleine Insel Combu, keine zehn Bootsminuten von der brasilianischen Stadt Belém entfernt. Die Metropole liegt am Rande des Amazonasdeltas. Dort säumen Mangroven die Ufer, es gibt Kakaobäume, Açaí-Palmen und Pfahlbauten aus Holz.
Charles hat an diesem Samstagnachmittag hohen Besuch: Der deutsche Bundesumweltminister Carsten Schneider hat an seinem Holzsteg mit einem Boot angelegt und steht nun mit einer Schar Journalisten in Charles' Waldstück. Der Brasilianer zeigt ihnen, wie man Kautschuk gewinnt, klettert behände eine aalglatte Palme hinauf, um dem Minister Açaí-Beeren zu bringen – und erzählt seine Geschichte: »Ich habe früher als Holzfäller gearbeitet«, sagt er. »Doch dann habe ich mich umorientiert und verstanden, dass ich damit meine Heimat zerstöre.«
Ein Bekannter habe ihn umgestimmt, ihm gezeigt, wie man mit Tourismus auf der Insel Geld verdienen kann, mit Kunsthandwerk und auch der Beerenernte. Minister Scheider nickt anerkennend. Das ist gut, sagt er. »Denn geht es dem Amazonas schlecht, wir werden das auch in Deutschland dramatisch spüren.«
Bäume retten mit der Börse?
Vier Tage später ist der Umweltminister zurück auf dem Klimagipfel im Zentrum von Belém und kündigt an, dass Deutschland eine Milliarde Euro für einen neuen Fonds zum Schutz des Regenwalds bereitstellt – über einen Zeitraum von zehn Jahren. Die Zusage war erwartet worden – nun, zur Endphase der Verhandlungen der 30. Uno-Klimakonferenz, stärkt Deutschland den Brasilianern damit den Rücken.
Doch die Tropical Forest Forever Facility (TFFF) ist nicht noch ein Geldtopf von vielen, sondern geht neue Finanzierungswege – und wird dafür gelobt und kritisiert.
Die Idee des Fonds kommt von der brasilianischen Regierung. Anders als bei herkömmlichen Fonds für Umweltschutz soll dort eingezahltes Geld in Entwicklungsländer investiert werden, um Gewinne zu erzielen. Ein Teil der erhofften Rendite soll an die Investoren zurückfließen und schließlich auch an Länder mit Tropenwäldern. Das Geld soll nur an jene fließen, die Regenwälder nachweisbar erhalten. Das soll dann mittels Satellitenaufnahmen überprüft werden.
Laut der Idee der Fondsgründer sollen so auch Menschen wie Charles auf der Insel Combu belohnt werden, weil sie ihren Wald schützen – und nicht aus Not wieder zum Holzfäller werden. Indigene Gemeinschaften weltweit, die laut Experten die Regenwälder am nachhaltigsten schützen, aber in prekären Verhältnissen leben, sollen zu den Gewinnern des Fonds gehören.
Das klingt zunächst einleuchtend: Wer Wald schützt, wird belohnt – und die Anleger haben auch noch etwas davon. Es ist der Versuch, dringend benötigtes Geld für den Waldschutz über die Kapitalmärkte einzusammeln – weil immer weniger Länder bereit sind, staatliche Mittel für Umwelt- und Klimaschutz auszugeben. Geld verdienen und Gutes tun – so die Idee.
Für den Start sollen 25 Milliarden Dollar von Staaten als Absicherung eingesammelt werden, damit private Investoren weitere hundert Milliarden Dollar nachschießen. Brasilien rechnet langfristig mit bis zu vier Milliarden Dollar pro Jahr für den Waldschutz. Mit der deutschen Zusage vom Mittwoch konnten die Brasilianer für ihre Idee nun bereits fast sieben Milliarden Dollar einsammeln.
Kritik aus der Wissenschaft
Doch nicht alle sehen in dem neuen Schutzfonds ein »Juwel des grünen Kapitalismus«. In einem offenen Brief kritisieren etwa neun Forscher, unter anderem der australischen Griffith University, die Methodik der TFFF scharf.
Die Autoren warnen, die TFFF lege die falschen Kriterien für den Waldschutz an. Damit Geld fließt, genügen laut TFFF-Kriterien bereits 20 bis 30 Prozent Kronenbedeckung – ein Wert, der »nicht wissenschaftlich glaubwürdig« sei, da intakte feuchte Tropenwälder üblicherweise bei über 70 Prozent lägen, heißt es in dem Brief. Die Waldexpertin und Mitautorin Kate Dooley von der University of Melbourne sagt: In der jetzigen Fassung »würde (die TFFF) Zahlungen erlauben, selbst wenn industrielle Holzernte in Primärwäldern stattfindet« – ein Fehlanreiz, der Walddegradation fördere.
Um die Zerstörung zu messen, solle zudem nur Feuer als Indikator gelten. Das sei irreführend. »Ein Feuer in feuchten Tropenwäldern zeigt, dass der Wald bereits seit einiger Zeit stark degradiert ist«, sagt Dooley. Und ihr Kollege Bill Laurance von der James Cook University erklärt in einem Beitrag der Yale School of Environment , moderne Satelliten und KI könnten Abholzung, Straßenbau und Bergbau längst zuverlässig erkennen. Solche Kriterien für Waldzerstörung würden aber außen vor gelassen.
Noch sei zudem unklar, ob etwa forstwirtschaftliche Nutzung von Wäldern und Naturschutzgebiete gleichbehandelt werde, kritisieren die Forscher. Sollte legale Forstwirtschaft erlaubt sein, müsse die TFFF unbedingt zwischen drei Waldkategorien unterscheiden: erstens sekundäre Naturwälder, bei denen Holz zu kommerziellen Zwecken entnommen wird; zweitens degradierte Naturwälder, die sich regenerieren müssen, in denen also nicht gefällt werden darf; und drittens Primärwälder, die unter umfassenden Schutz gestellt werden. Die Gelder dürften nicht an alle gleich verteilt werden, heißt es.
Auch aus Indigenen-Gemeinden kommt Skepsis. Zwar schreibt der TFFF-Fonds vor, mindestens ein Fünftel der Mittel »direkt oder indirekt« an Indigene und Waldgemeinschaften zu lenken. Doch die Nichtregierungsorganisation Global Forest Coalition glaubt, Regierungen könnten Gelder über Behörden oder Privatfirmen kanalisieren – und damit lokale Gemeinschaften übergehen.
Das befürchtet auch Jannes Stoppel von Greenpeace: »In Brasilien haben die indigenen Gemeinschaften ein gutes Standing, sie haben sogar ein eigenes Ministerium. In anderen Ländern ist die Situation viel schlechter.« Zu befürchten sei, dass manche Länder die Gelder nicht an indigene Gruppen, die möglicherweise sogar unterdrückt oder verfolgt werden, auszahlen, befürchtet Stoppel.
Auch das Fondsmodell halten einige für riskant. So gehen die eingezahlten Gelder in Anleihen von Schwellen- und Entwicklungsländern. Diese haben ein höheres Ausfallrisiko und daher recht hohe Zinsen. Doch bei einem Ausfall gibt es auch keine Rendite und damit auch kein Geld für den Wald. Der Ökonom Max Alexander Matthey von der Universität Witten/Herdecke hält das für ziemlich riskant und unfair. Die Erfolgsaussichten des Fonds seien extrem konjunkturanfällig. So könnte ein großer Marktcrash den Wert des Fonds dezimieren, Zahlungen aussetzen und so auch die TFFF-Idee bedrohen.
Hoffen aufs Kapital, ringen um staatlichen Waldschutz
Während die Brasilianer schon jetzt die TFFF als großen Erfolg der COP30 verkaufen, sieht es mit dem Waldschutz auf Staatenebene weitaus schlechter aus. Auf der Uno-Klimakonferenz in Glasgow vor vier Jahren hatten sich mehr als 140 Länder verpflichtet, die globale Waldzerstörung bis 2030 zu stoppen. Davon ist man weit entfernt. Auch in Belém wird seit zwei Wochen um einen Fahrplan gerungen, diesem Ziel näherzukommen. Bisher seien die Verhandlungen noch sehr verfahren, ähnlich wie beim Fahrplan für einen Ausstieg aus fossilen Energieträgern.
Weltweit ist im vergangenen Jahr einer Analyse zufolge Wald auf einer Fläche von mehr als acht Millionen Hektar vernichtet worden, das entspricht 90 Mal der Fläche von Berlin. Auch im Vergleich zum Beginn des Jahrzehnts hat die Zerstörung kaum abgenommen.
Hinzu kommt: Trotz großer Klimabekenntnisse auf der COP sägt die EU parallel am staatlichen Waldschutz. Gerade steht ein zentraler Pfeiler der europäischen Waldpolitik zur Disposition: Unter dem Schlagwort »Entbürokratisierung« verschob der EU-Ministerrat die Entwaldungsverordnung um ein Jahr. Die Zentralverbände des Deutschen Handwerks und des Deutschen Baugewerbes feierten den »Teilerfolg«.
Die Verordnung sollte eigentlich ab dem 30. Dezember gelten. Produkte wie Kaffee, Holz, Soja, Kakao und Palmöl dürfen dann laut der Verordnung nur noch in der EU verkauft werden, wenn dafür nach 2020 keine Wälder gerodet wurden. Konkret müssen Unternehmen künftig eine Sorgfaltserklärung abgeben. Ob das nun 2026 wirklich so kommt, ist weiterhin unklar. Gerade kleine Betriebe sollten bürokratisch sicher nicht überlastet werden, dennoch ist mehr Kontrolle angesichts der Folgen für die Umwelt und das Weltklima angebracht.
Denn gerade der Konsum der Europäer heizt die weltweite Entwaldung an, wie eine Studie im Auftrag des WWF zeigt. Der Konsum von Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee, Rindfleisch sowie Industrieholz und Kautschuk hat demnach von 2021 bis 2023 weltweit zur Rodung von 149 Millionen Bäumen geführt.
Jede Minute würden für EU-Bürger im Durchschnitt hundert Bäume gefällt, zitiert der WWF auf der COP30 aus der Studie. Allein der deutsche Konsum führe zu einem Verlust von 13 Millionen Bäumen pro Jahr.
Große Worte und Versprechen in Belém sind gut, Gelder für Waldfonds jedoch wenig wert, wenn gleichzeitig staatliche Waldschutzregeln gekippt werden.
Der SPIEGEL berichtet für Sie von der COP30 aus Belém. Alle Beiträge finden Sie immer laufend aktualisiert hier.
Wenn Sie mögen, informieren wir Sie einmal in der Woche über das Wichtigste zur Klimakrise – Storys, Forschungsergebnisse und die neuesten Entwicklungen zum größten Thema unserer Zeit. Zum Newsletter-Abo kommen Sie hier.
Die SPIEGEL-Beiträge zur COP30 in Belém:
Brasiliens ungewöhnliche Taktik auf der Klimakonferenz: das Lula-Prinzip
Brasiliens Diplomaten beherrschen eine legendäre Taktik, mit der ihnen auf der Klimakonferenz ein Durchbruch gelingen könnte. Der Präsident spielt dabei eine besondere Rolle.Weltklimagipfel in Brasilien: Glanz und Elend von Belém: Eine Stadt am Limit
Die Regenwaldmetropole richtet die Weltklimakonferenz aus. Gleichzeitig ist sie Schauplatz von dramatischen Folgen des Klimawandels. Vor allem die armen Bewohner trifft die Tragik der Erderhitzung.Zehn Jahre Weltklimaabkommen: »Das Ausmaß des Rückschlags habe ich so nicht erwartet«
Laurent Fabius gilt als Architekt des Pariser Klimaabkommens. Im Interview verrät der französische Ex-Außenminister, wie er vor zehn Jahren fast 200 Staaten zum Konsens bewegte und was heute anders laufen muss.Klimakonferenz in Belém: Brasilien wagt sich an das große Tabu
Viele Teilnehmer reisten mit gedämpften Erwartungen zur diesjährigen Uno-Klimakonferenz. Doch Gastgeber Brasilien sorgt in Belém für eine bemerkenswert positive Atmosphäre – und hat sich Großes vorgenommen.Klimaschutz: Es kommt auf den Staat und auf den Einzelnen an
Wer möchte, kann ruhig Fleisch essen und fliegen, weil nur der Staat in Sachen Klimaschutz effektiv ist? Diese Argumentation basiert auf fünf Falschannahmen.Amerikas einflussreichste Energiestrategin: »Wir lassen uns von niemandem hindern, unser Öl und Gas zu nutzen«
Von E-Autos und Solarenergie hält sie nichts, von Kohle viel: Diana Furchtgott-Roth hat im Project 2025 Donald Trumps radikale Energiewende vorgezeichnet. Glaubt sie wirklich, dass die USA so gegen China bestehen können?G20-Gipfel und COP-Konferenz: Keine Weltordnung, nirgends
Wer regiert eigentlich die Welt? Obwohl sie bei all den globalen Problemen dringend gebraucht würde, ist die alte Ordnung nur noch schemenhaft erkennbar. Ein Zeitalter des Weiterwurstelns ist angebrochen.Deutschland hat zu hohe Klimaziele und ist damit allein? Ganz und gar nicht
Die Klimaziele müssen runter, Deutschland ist zu ehrgeizig. Solche Behauptungen sind nicht nur falsch, sondern auch ökonomisch unplausibel. Wer weltpolitisch mitspielen will, sollte Vorreiter werden, zeigt das Uno-Klimatreffen in Belém.»Viele Menschen hier leben heute entkoppelt von der Natur«
Der Umweltschützer Ma Jun hat einst mit einer bemerkenswerten Kampagne dafür gesorgt, dass der Himmel über Peking wieder blau wurde. Wie blickt er heute auf die Klimapolitik seines Landes?Initiative auf der Weltklimakonferenz: Neue Luxussteuer auf Flüge spaltet die Koalition
Zahlreiche Staaten wollen Business-Class-Kunden und Privatjet-Passagiere zur Kasse bitten, um Klimaschutz in armen Ländern zu unterstützen. Die deutsche Regierung ist bei der Frage uneins – und macht daher erst mal nicht mit.
Bleiben Sie zuversichtlich!
Ihre Susanne Götze
Redakteurin Wissenschaft
Umweltminister Carsten Schneider mit Charles auf der Insel Combu: Vom Holzfäller zum Waldretter
Foto: Susanne GötzeIllegale Goldmine im Amazonas-Regenwald: Straßen und Minen werden nicht berücksichtigt
Foto: ? Enrique Castro-Mendivil / Reuters/ REUTERSHolzeinschlag im brasilianischen Amazonas-Regenwald
Foto: Ueslei Marcelino / REUTERSAmazonas-Regenwald und degradierte Waldfläche als Acker: Zerstörung unattraktiv machen
Foto: Paralaxis / Getty ImagesVerbrannte Bäume im Amazonas-Regenwald
Foto: Adriano Machado / REUTERS